Wichtige Klimadaten vor dem Aus: Bremer Forschungsteam rettet amerikanische Umweltdaten vor dem Rotstift
WissenschaftWie die Hansestadt eine leitende Stellung im Forschungsdatenmanagement einnimmt

Es ist für die Wissenschaftsgemeinschaft eine Hiobsbotschaft unter vielen, die derzeit aus den Vereinigten Staaten kommen: Im Zuge der Budgetkürzungen der Trump-Regierung musste die Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), seit Februar 2025 rund 2.200 Mitarbeitende entlassen und mit 30 Prozent weniger Finanzmitteln auskommen.
Dabei sind die Dienste der NOAA für die globale Erdbeobachtung unverzichtbar. Die Behörde verwaltet einen gewaltigen Datenschatz – mit Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 2100 v. Chr. zurückreichen. Doch nun droht ein Teil dieses Wissens verloren zu gehen: 20 Datenbanken sollen abgeschaltet werden. Sie enthalten Informationen, die weltweit in der Wetter- und Klimaforschung genutzt werden.
Für die internationale Wissenschaftsgemeinschaft war das ein Schlag – mit potenziell globalen Konsequenzen. Forschende auf der ganzen Welt greifen regelmäßig auf die NOAA-Daten (etwa die „Billion Dollar Weather and Climate Disasters“-Database) zurück. Die Reaktionen auf den Hilferuf aus den Reihen der NOAA-Mitarbeitenden fielen dementsprechend alarmiert aus.
Weltweite Unterstützung für verwaiste Forschungsdaten – auch Bremen dabei
In wenigen Wochen formierte sich internationale Unterstützung – auch aus Bremen. Dort reagierte Professor Frank Oliver Glöckner, Gesamtleiter des gemeinsamen PANGAEA-Informationssystems1 des Alfred-Wegener-Instituts und des MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften sowie Professor für Erdsystem-Datenwissenschaften an der Universität Bremen. In einem LinkedIn-Post bot er unter anderem an, PANGAEA als sicheren Hafen für die bedrohten NOAA-Daten bereitzustellen.
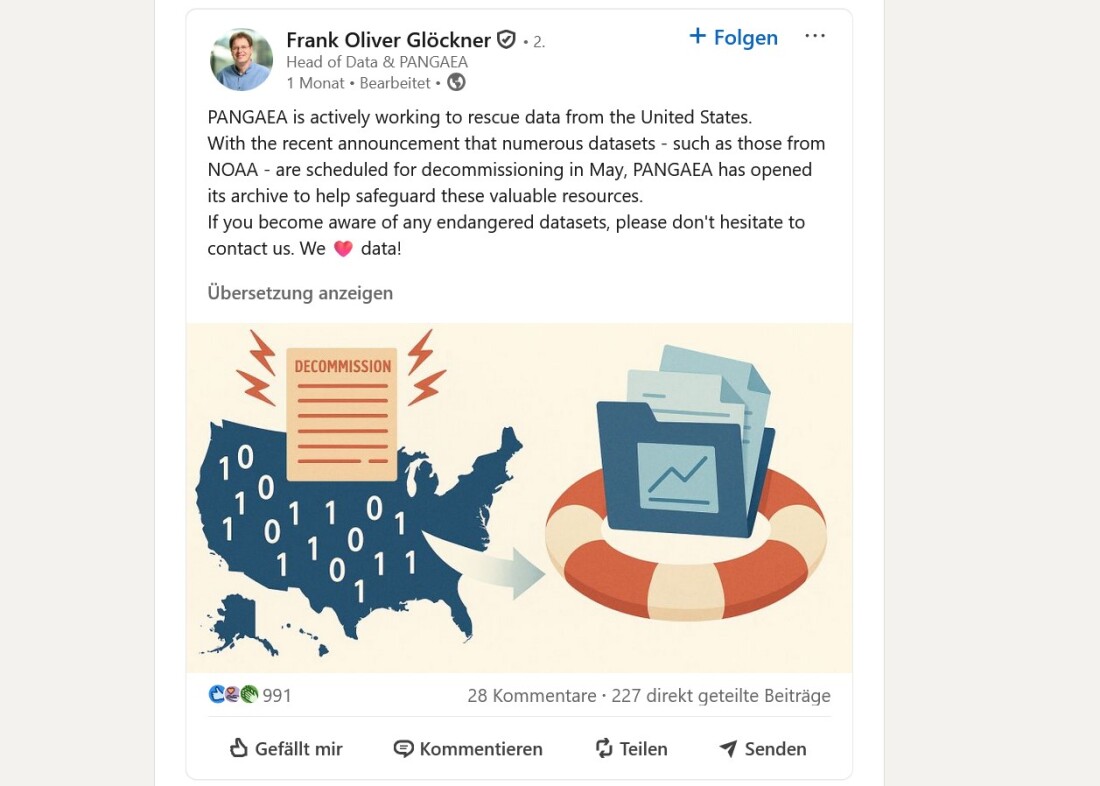
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Das Bremer Team schloss sich dem weltweit koordinierten Data Rescue Project zur Rettung der NOAA-Daten an – und übernahm einen Teil des bedrohten Datenbestands. „Wir waren ganz schön beschäftigt in den vergangenen Wochen“, blickt Professor Glöckner zurück. „Man merkt oft erst, wie wertvoll etwas ist, wenn es plötzlich nicht mehr da ist.“
Führende Datenbank für Geo- und Umweltwissenschaften aus Bremen
Dass Glöckner und sein Team den Forschungsdaten ein neues Zuhause bieten konnten, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Pionierarbeit. Die Wurzeln von PANGAEA reichen bis ins Jahr 1987 zurück. Der Grundgedanke damals wie heute: Forschungsdaten sollen langfristig gesichert, zugänglich gemacht und öffentlich nutzbar sein.
Denn das war lange Zeit ein Problem. Zwar veröffentlichen Wissenschaftler:innen ihre Ergebnisse in Fachzeitschriften, die zugrunde liegenden Daten bleiben jedoch häufig auf lokalen Rechnern – unzugänglich für andere. Dabei könnten Forschende mit ähnlichen Fragestellungen diese Daten weiterverwenden oder neu auswerten. Aus dieser Überlegung heraus entstand die Vision einer globalen Bibliothek für Forschungsdaten.
PANGAEA konzentriert sich auf Informationen aus den Erd- und Umweltwissenschaften. Heute umfasst die Plattform über 33 Milliarden Messungen in rund 440.000 Datensätzen – und gilt als die bedeutendste Datenbank für numerische Erd- und Umweltdaten, also alles, was georeferenziert ist und sich tabellarisch erfassen lässt.
Die Inhalte reichen von Messwerten treibender Bojen im Atlantik bis hin zu Sensordaten von Forschungsschiffen wie der Polarstern. „Das Besondere an unserer Datenbank ist, dass sie vollständig kuratiert wird. Jeder Datensatz wird von unserem Team geprüft und einheitlich aufbereitet“, erklärt Glöckner. Das ist entscheidend, denn uneinheitliche Formate können leicht zu Fehlern führen. Etwa wenn Temperaturdaten in einer Tabelle in Fahrenheit und in einer anderen in Celsius vorliegen.
Riesiger Datenschatz in Norddeutschland
Die PANGAEA-Datenbank ist längst nicht das einzige Repositorium (so der Fachbegriff für diese Art von Bibliotheken) in Bremen. Auch in anderen Disziplinen gibt es hier spezialisierte Einrichtungen: Qualiservice etwa archiviert qualitative Daten aus den Sozialwissenschaften, InterSystems IRIS fokussiert sich auf Gesundheitsdaten, openEASE dient der Künstlichen Intelligenz und am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) betreibt man ein Repositorium für Robotikdaten.
„Bremen hat hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal, wenn es um den Umgang mit Forschungsdaten geht“, betont Professor Glöckner. „Dabei zählt nicht nur die reine Datenmenge oder die Zahl der Repositorien, sondern vor allem der strukturierte und nachhaltige Umgang mit diesen Daten.“
Gerade in den vergangenen zehn Jahren habe Bremen seine Kompetenzen in diesem Bereich deutlich ausgebaut. Glöckner selbst ist mit seinem Team Teil der U Bremen Research Alliance (UBRA) – einem Zusammenschluss der Universität Bremen mit zwölf renommierten Forschungseinrichtungen. Ziel der Allianz ist es, interdisziplinär Know-how und Ressourcen zu bündeln.
UBRA-Leitprojekt „Forschungsdatenmanagement und Data Science“
Ein zentrales Vorhaben der UBRA ist das Forschungsdatenmanagement – ein Bereich von wachsender Bedeutung, denn durch die fortschreitende Digitalisierung nimmt die Menge an Aufzeichnungen rasant zu. Für viele Forschende wird es zunehmend schwieriger, mit dem Umfang möglicher Datenquellen umzugehen, sie aufzubereiten und zu bewerten.
Genau hier setzt das Leitprojekt der UBRA und das Bremer Datenkompetenzzentrum DataNord an. Es bietet ein Umfeld zum Forschen, Lernen und Vernetzen und bildet mit dem Ausbildungsprogramm Data Train gezielt Fachkräfte aus. Absolvent:innen qualifizieren sich hier zu sogenannten Data Stewards und Data Scientists – also Expertinnen und Experten für die strukturierte Verwaltung, Pflege und Auswertung wissenschaftlicher Daten.
„Wir beschäftigen hier in Bremen insgesamt 70 Personen im Bereich Daten- und Projektmanagement, die unsere Angebote pflegen und weiterentwickeln. Aber auch die Institute auf aller Welt, die mit unseren Daten arbeiten, brauchen Personal. Und das bilden wir hier aus. Wir sind ein Dienstleister, der Wissen bereitstellt. Auch für die Industrie, die ja ebenfalls von unseren Daten profitiert“, so Glöckner.
Welche herausragende Stellung Bremen im Bereich des Forschungsdatenmanagements einnimmt, zeigt auch eine andere Zahl. So sind Bremer Projekte, Institute und Forschende Teil von zwölf der insgesamt 26 Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Die NFDI hat es sich zum Ziel gesetzt, deutschlandweit Datenbestände systematisch zu erschließen und allen zur Verfügung zu stellen und dazu einzelne Teil-Projekte, die Fachkonsortien, geschaffen.
Wissen für alle – wie sich Dateninfrastrukturen finanzieren
All diese Arbeit kostet Geld – sei es für leistungsfähige Rechenzentren, gut ausgebildetes Fachpersonal oder gezielte Ausbildungsprogramme. Und dennoch sind die Repositorien frei zugänglich. Wie lässt sich das finanzieren?
„Die Finanzierung ist oft projektabhängig und erfolgt über unterschiedliche Quellen, etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR, früher BMBF) oder der Europäischen Union, jedoch sind wir in der glücklichen Lage, dass rund die Hälfte der aktuellen Finanzierung dauerhaft durch das MARUM und das AWI zur Verfügung gestellt wird“, erklärt Professor Glöckner. Doch hinter dieser Förderung stecke weit mehr als reine Wissenschaftsförderung aus Idealismus, fährt er fort:
„Daten sollten die Grundlage jeder evidenzbasierten Entscheidung sein – in der Wissenschaft genauso wie in Politik und Wirtschaft. Dafür brauchen wir zuverlässige, gepflegte und zugängliche Datenbanken, die solche Entscheidungen überhaupt erst möglich machen.“
FAIR-Prinzipien als Leitlinie
Um diese Anforderungen zu erfüllen, stellt Bremen sicher, dass alle Daten nach den sogenannten FAIR-Prinzipien verarbeitet werden. Das Kürzel steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable – also: auffindbar, zugänglich, kompatibel und nachnutzbar. Diese Prinzipien wurden 2016 von einer internationalen Gruppe von Forschenden formuliert2 und haben sich seither als globaler Standard für den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten etabliert.
Professor Glöckner betont, dass die Gesellschaft als Ganzes von dieser offenen Datenkultur profitiert: „Wir finanzieren Forschung mit Steuergeldern – also sollten auch die Ergebnisse allen zugutekommen. Unser Ziel ist es, diese Daten als Gemeingut so bereitzustellen, dass sie langfristig, fair, frei und für alle gleichberechtigt nutzbar bleiben.“
Referenzen
1 Felden, J; Möller, L; Schindler, U; Huber, R; Schumacher, S; Koppe, R; Diepenbroek, M; Glöckner, FO: PANGAEA – Data Publisher for Earth & Environmental Science. Scientific Data, 10(1), 347, https://doi.org/10.1038/s41597-023-02269-x (2023)
2 Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data 3:160018 doi: 10.1038/sdata.2016.18 (2016).
Tag der Forschungsdaten
Die U Bremen Research Alliance veranstaltet jährlich, im Rahmen des interdisziplinären Bremer Datenkompetenzzentrums DataNord, den Tag der Forschungsdaten. Dieses Jahr findet die Veranstaltung am 11. Juni 2025 unter dem Motto „FAIR future skills“ statt. Im Tagesprogramm (10-15 Uhr) auf dem Campus der Universität Bremen informieren Datenexpert:innen aus Bremen in interaktiven Austauschformaten, praxisorientierten Workshops und vielfältigen Vorträgen über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Forschungsdatenmanagement und Data Science.
Die Abendveranstaltung platziert das Thema Datenkompetenz mit dem FAIR-Prinzip dann in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang: Unter dem Motto „Gemeinsam Daten nutzen - FAIRe Lösungen für eine bessere Gesellschaft“ findet ab 18 Uhr eine öffentliche Veranstaltung in der Bremischen Bürgerschaft statt. Hier diskutieren Expert:innen aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft darüber, welche Formen der Zusammenarbeit notwendig sind, um durch Datenkompetenz wirksame Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Weitere Infos zum Tag der Forschungsdaten: www.tag-der-forschungsdaten.de
Erfolgsgeschichten
Welche Raumfahrtmissionen ab 2026 von Bremen aus ins All starten
Bremen ist aus der internationalen Raumfahrt nicht wegzudenken. Auch in den kommenden Jahren starten von Bremen aus neue Raketen, Satelliten und Experimente ihre Reise ins All. Ein Überblick über künftige Missionen.
Mehr erfahrenWissenschaft persönlich: Dr. Tobias Wolff
Dr. Tobias Wolff ist Leiter für Ausstellung und Entwicklung im Universum® Bremen. Der promovierte Meeresgeologe gestaltet heute faszinierende Dauer- und Sonderausstellungen und bringt wissenschaftliche Themen auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Wie sein perfekter Freimarktstand aussehen würde und was ihn an seiner Arbeit besonders begeistert, verrät er bei „Wissenschaft persönlich“.
Zu "Wissenschaft persönlich"Wissenschaft persönlich: Dr. Christel Trouvé
Dr. Christel Trouvé ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Landeszentrale für politische Bildung Bremen. Darüber hinaus hat sie die wissenschaftliche Co-Leitung des Denkorts Bunker Valentin in Bremen-Farge inne. Wieso die französische Historikerin in Bremen gelandet ist und welche gesellschaftliche Bedeutung ihre Arbeit hat, erzählt sie bei „Wissenschaft persönlich".
Zu Wissenschaft Persönlich